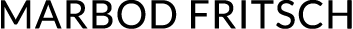„Sehen wir etwas, wenn wir nichts erwarten?“
Die künstlerischen Arbeiten von Marbod Fritsch sind Denk- und Handlungsräume, egal ob es sich um Zeichnungen, Malereien oder konzeptuelle Projekte handelt. Er bedient sich textueller und zeichenhafter Codes, um die Auflösung und Erzeugung von Realität zu thematisieren. Er hat Interventionen im öffentlichen Bereich und Kunst-am-Bau-Projekte verwirklicht, die medial für grosses Aufsehen sorgten. Karlheinz Pichler unterhielt sich mit dem Künstler über sein aktuelles Schaffen.
Karlheinz Pichler: Noch vor wenigen Jahren warden Sie mehr oder weniger ausschliesslich als Zeichner bekannt. In der jüngeren Vergangenheit rückte das konzeptionelle Schaffen, besonders die Konzentration auf den öffentlichen Raum und die Kunst am Bau aber stärker in den Vordergrund. Von aussen betrachtet erinnert das ein wenig an das Dr.-Jekyll-und-Mr.-Hyde-Syndrom: als ob Ihr künstlerisches Werk von zwei völlig unterschiedlichen Positionen getragen wäre. Täuscht dieser äussere Blick, respektive wo liegen die Berührungspunkte zwischen dem zeichnenden und dem konzeptionell operierenden Künstler Marbod Fritsch?
Marbod Fritsch: Ich glaube, das täuscht ein wenig. Die konzeptuellen Arbeiten waren immer schon Teil meiner künstlerischen Praxis. Nur wurden Sie in der Öffentlichkeit nicht so stark wahrgenommen. Sie entstanden und enstehen meist anlassbezogen. Im konzeptuellen Bereich reagiere ich stärker auf vorgegebene Situationen, lasse mich auf den Raum, die vorhandenen thematischen Rahmenbedingungen ein. Ich versuche, dort für mich relevante Anknüpfungspunkte zu entdecken, um meine Geschichte weiter zu erzählen.
K.P.: Zeichnen Sie im Moment überhaupt noch? Wie gewichten Sie momentan die zwei „Productlines“ Zeichnung und Konzeptkunst?
M.F.: Im Moment habe ich einer Serie begonnen, die ich nach dem Werkzeug, das ich verwende, benenne. Das Zeichengerät heisst „Fine Black Pilot“. Ich finde, dass das ein schöner, für die Arbeit passender Titel ist. In diesen Arbeiten konstruiere ich unmögliche Räume. Ein wenig erinnern sie an Detailaufnahmen aus Escher-Bildern. Die Gewichtung ergibt sich aus den Projekten, in die ich involviert bin. Es kann durchaus sein, dass ich einige Monate nicht zeichne, danach wieder einige Monate durchgehend. Das Handzeichnen brauche ich wie ein Marathonläufer das Konditionstraining, es gibt aber bei mir keine vorgegebene Trainingszeiten
K.P.: Mit Konstruktionen wie „Moving Earth“ und „Separation Point“, der Bahnschranke in der Harder Bucht, sind Sie ins Land hinaus gegangen. Können Sie mir sagen, ob und wie weit folgende Überlegungen mit eine Rolle gespielt haben:
- Weg vom sterilen, abgesteckten White Cube in die Natur und zu den Menschen
- Interaktion und Integration des Betrachters – und zwar in dessen natürlichen Umraum
- Der Reiz der Landart, der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem natürlichen und dem kultivierten Raum
- Beide Arbeiten sind Technik-getrieben: der Pioniergedanke der technischen Eroberung und Durchdringung der Archaik und monumentalen Gewalt der Natur.
M.F.: Es ist spannend, Projekte ausserhalb einer Galerie oder eines Museums zu realisieren. Damit ich auch im öffentlichen Raum die Menschen erreiche, fühle ich mich gezwungen, noch präziser zu sein. Bestimmte Vorgaben erleichtern mir manchmal die Arbeit, sie stecken den Raum für mich ab. Darin muss/kann ich mich mit meinem Werk, meiner Idee positionieren. Ich versuche dann, eine für mich schlüssige Bild- und Formensprache zu finden. Bei beiden Projekten war mir bald klar, dass ich im Aussenraum arbeiten möchte. Dass dazu Motoren oder sonstige Technik verwendet werden, ergibt sich für mich aus der Idee. Da sind viele Umwege notwendig, um schlussendlich zu einer für mich befriedigenden Lösung zu gelangen.
K.P.: Betrachtet man die Kunst-am-Bau-Arbeiten landauf landab, dann dominieren gattungsmässig Skulpturen und grossformatige Malereien klar. Viel seltener lassen sich mediale und prozessuale Arbeiten ausfindig machen. Ihr Beitrag für das (BSBZ) Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum für Vorarlberg in Hohenems ist eine solche prozessuale Arbeit. Derartige Projekte bewirken naturgemäss, da sie ja stark an das Bauwerk gekoppelt sind, eine Einengung der künstlerischen Freiheit, andererseits stellen sie aber eine grosse Herausforderung an den Künstler dar.
Wie haben Sie sich an das Unternehmen Hohenems aus dieser Sicht angenähert? Wie sind Sie mit dieser Kluft, die eine solche Lösungsfindung begleitet, umgegangen? Das ist ja ein Problem, das sämtliche wettbewerbsbasierten Kunstunternehmungen begleitet.
M.F.: Wie schon oben erwähnt, machen mir Vorgaben für meine künstlerische Praxis nichts aus. Kunst-am-Bau ist generell ein schwieriges Unterfangen, die Planung ist meistens soweit fortgeschritten, dass eine gröbere Intervention - auch wegen der Kosten - ausbleiben muss und konventionelle Lösungen eher bevorzugt werden. Wobei ich konventionell nicht pauschal mit schlecht gleichsetzen möchte.
Meine Arbeit in Hohenems nennt sich „Zur Natur des Bildes“. Was macht ein Bild aus, was ist notwendig, damit etwas zum Bild wird? In diesem Sinn geht es ums Lernen, um Kommunikation im weiteren Sinn. Ich habe von Anfang an versucht, die zuständigen Stellen in den gesamten Prozess einzubinden und meine Position verständlich zu machen. Beide sollten wir voneinander lernen. Ich wollte kein Zwangsbeglücker sein, sondern meine Arbeit sollte in dieser Schule ihren Platz bekommen.
K.P.: Bei Ihrer Arbeit in Hohenems muss der Betrachter „einen bestimmten Standpunkt“ einnehmen, um die Arbeit „erkennen“ und verstehen zu können. Auch bei Ihrem Beitrag für die Ausstellung „Heimspiel“ im Kunstmuseum St. Gallen war der Betrachter gefordert. Er musste visuell gar nicht so leicht entzifferbare Buchstaben aufnehmen und aneinanderreihen, um das Statement Godards „Real ist, was zwischen den Dingen ist und nicht das Ding selbst“ „lesen“ und registrieren zu können. Ist der Faktor Mensch zur bestimmenden dritten Dimensionen in Ihrer Arbeit geworden – wenn man davon ausgeht, dass Intuition und Konstruktion bisher sowohl für Ihre Zeichnungen wie auch für Ihre konzeptionellen Objekte und Installationen als die zwei massgebenden Faktoren anzusehen waren.
M.F.: Wir sehen, was wir erwarten. Aber sehen wir etwas, wenn wir nichts erwarten? Das könnte als Überschrift bei diesen Werken stehen. Durch ihren hohen ästhetischen Reiz funktionieren die beiden Werke einerseits als reine Malerei oder ornamentale Skulptur. Wenn der Betrachter aussen bleibt, dann wird er nie mehr erkennen (können). Die Form des Textes ist so gewählt, dass die Lesbarkeit des Textes bzw. dessen Auflösung ins Ornamentale sehr knapp nebeneinander liegen d.h. die Bedeutungsebenen ständig hin und herwechseln. Es ist eine Herausforderung für mich, dass dieser ästhetische Reiz die weiteren Ebenen nicht verdeckt. Und eine Herausforderung für den Betrachter zu den Schichten vorzudringen.
K.P.: Was erwarten Sie also konkret vom Betrachter, was muten Sie ihm tatsächlich zu?
M.F.: Das Erleben meiner Arbeit ist für den Betrachter sicher unmittelbarer und direkter geworden. Aber gleichzeitig wird er dabei auch mehr gefordert. Der Betrachter soll über den visuellen Anreiz die dahinterliegenden Schichten entdecken können. Dieses Erleben des ständigen Hin und Herkippens zwischen ästhetischem Erleben und der Wahrnehmung einer dahinterliegenden Schicht (Text/Textur) wäre mir wichtig.
K.P.: Sie verwenden in den letzten Jahren verstärkt Texte als künstlerisches Material: inwieweit spielt da das dekonstruktive und rekonstruktive Moment eine Rolle? Zur Erklärung: beispielsweise gehen Sie in St. Gallen von diesem Godard-Satz aus: Sie verwenden ihn, um einen Bildraum zu erzeugen, eine Gesamtheit. Der Satz verweist auf das Kunstwerk, hebt es aber gleichzeitig auf. Liest der betrachter den Satz nicht, registriert er das Kunstwerk als gläsernen Kubus, der in die Architektur integriert ist - es ist ja der Windfang. Erst durch die Entschlüsselung des Satzes entsteht eine völlig neue Dimension des Kunstwerkes. Erst die Fähigkeit des Betrachters, den Text zu decodieren, entfaltet sich die ganze Tragweite. Ohne diese Decodierung durch den Betrachter bleibt das Werk auf sich zurückgeworfen. Erst durch den Betrachter erhält es diese inhaltliche Ausdehnung.
M.F.: Den Mehrwert schafft der Betrachter selbst. Der Satz von Godard ist im Moment der Leitgedanke meiner Arbeiten. Er findet sich sowohl als Satz selbst in Textarbeiten als auch Ausgangspunkt von Objekte und Installationen wieder. „Real ist, was zwischen den Dingen ist und nicht das Ding selbst“ stand auf dem Windfang des Museums in St. Gallen. Der Windfang befindet sich genau zwischen dem Innen und dem Aussen, also genau zwischen den Dingen, gleichzeitig aber ist er wiederum ein Ding, also laut Godard nicht real. Wer es entschlüsselt, erkennt, dass diese Rückkopplung stattfindet. Diese Situation hat mich interessiert.
K.P.: Das heisst diese Arbeiten sind denn auch komplexitätsgetragen. Sie bauen auf mehreren Dimensionen auf. Auch die Hohenemser Arbeit. Mehrere (Kunst)- und Farbräume werden aufgezogen. Erst in der Übereinanderlappung, die sich durch die Betrachtung vom richtigen Standpunkt aus ergibt, wird die Tragweite sichtbar. Kurz, Sie gehen von einer Schriftlichkeit aus. Diese wird von Ihnen decodier, in dem Sie sie in Räume und Farbe zerlegen. Dann wird der Betrachter beigemischt. Dieser muss wie ein Art Enigma (Decodiermaschine) funktionieren, sprich seinen Beitrag leisten. Dann wird das Werk quasi neu konstruiert - im Bewusstsein des Betrachters - und zu einer Gesamtkonstruktion verschmolzen. Die Komplexität spielt also eine enorme Rolle. Oder widersetzen Sic sich dieser Schlussfolgerung?
M.F.: Nein, überhaupt nicht. Es interessiert mich, durch Verdichtung und Überlagerung von verschiedenen Bedeutungsebenen eine neue durchlässige Schicht zu erzeugen.
- REMAIN IN LIGHT | Patrick Fürnschuß
- Der Grundsatz der Wörter und die Fäden des Wirklichen | thomas D. Trummer
- Interview Volksblatt | Ausstellung Engländerbau | Elmar Gangl
- "Wenn sie mich verstanden haben, dann habe ich mich falsch ausgedrückt" | Jean Luc Godard
- Biographie | Hohenems | Hanno Loewy
- For Your Eyes Only / Hans Platzgumer
- Zeichnungen, die sich in den Raum hinein ausbreiten
- Interview / Bühnenbild
- Easy come easy go
- sünden.phall
- Die Zerstörung eines Bildes von Marbod Fritsch / Wolfgang Mörth
- Aus dem Bild heraustreten
- gates | beijing | Bridget Noetzel
- asylum
- Die Schranke – Überlegungen zu einem ambivalenten Objekt
- Der stumme Gesang der befreiten Schranke / Wolfgang Hermann
- „Sehen wir etwas, wenn wir nichts erwarten?“
- TEXT-PASSAGEN
- ZUR NATUR DES BILDES